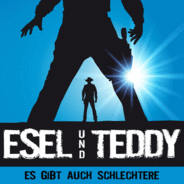Seit 18 Jahren und 800 Folgen machen wir Blödsinn – jetzt wollen wir etwas Sinnvolles tun.
Gemeinsam mit euch möchten wir einen Wald pflanzen! Pro gespendeten 3 € wird in Nicaragua ein Baum gesetzt – so wächst mit eurer Hilfe nicht nur unsere Dankbarkeit, sondern auch ein echter Wald. Einfach nur, weil es uns und euch gibt.
Ob ein kleiner oder ein großer Beitrag: Jeder Baum macht einen Unterschied! Und wir belohnen jede Spende zusätzlich damit, dass ihr Paten einer unserer Episoden werden könnt: Wir tragen euch in den Folgentext mit dem Spender*innennamen eurer Wahl ein.
Hier geht’s direkt zur Aktion:
https://spenden.twingle.de/primaklima-e-v/spa-feiern-fuer-den-wald
Folgen von Esel und Teddy
777 Folgen
-
Folge vom 26.10.2025Episodenpaten mit Spendenspaten
-
Folge vom 19.10.2025Bleistifte weg!Warum hat der Esel heute keine Lust auf Shownotes? Weil er immer nur iaaah-nfangt, aber nie endet! Er ist schließlich nicht Rainer Mar-iaaah Rilke und außerdem will er seinen Urlaub an der Adr-iaaah genießen und hat keine Zeit. Links zur Folge https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.scherzfragen-fuer-kinder-mhsd.556b47db-8e62-48cf-9436-07dcb3ea6080.html https://www.instagram.com/ms_pencilsaway/
-
Folge vom 12.10.2025Müllers Morpho-MaschineEs war ein grauer Nachmittag, das Leben sah aus, als hätte es vergessen, den Kontrastregler hochzudrehen. Esel und Teddy fuhren die Landstraße entlang, auf dem Rückweg von einem Podcastertreffen – irgendwo zwischen Kreisverkehr und Nirgendwo – auf der Suche nach einem Imbiss, der noch Vertrauen in warme Würstchen hatte. Da stand er plötzlich: ein kleiner, windschiefer Krämerladen. Das Schild über der Tür hing schief und trug in verblichenen Buchstaben das Wort „Morpho“. Der Schmetterling daneben war aus Metall, aber seine Flügel bewegten sich im Wind. Er sah fast lebendig aus. Drinnen roch es nach vergangenen Jahrzehnten. Zwischen verstaubten Regalen, in denen Bonbontüten und Batterien einander Gesellschaft leisteten, stand sie: eine große, blaue Box mit einem leuchtenden Bildschirm und einem Schlitz wie ein gieriger Mund. Darauf stand: „Erkenne dein Potenzial. 1 Euro.“ „Das ist ja wie ein Glückskeks mit Stromanschluss“, murmelte Teddy und warf eine Münze ein. Ein Summen, ein Brummen, ein Licht – die Maschine vibrierte, als würde sie denken. Dann spuckte sie eine kleine, blaue Karte aus. Teddy zog sie vorsichtig hervor. Darauf stand in klaren Lettern: „Wanderer – Der Weg ist heute die Antwort.“ „Passt“, sagte Teddy leise. „Ich bin ja schon unterwegs.“ Esel nickte, drückte eine eigene Münze in den Schlitz. Wieder das Brummen, das Summen, das leise Klicken. Seine Karte roch nach Druckerwärme und Schicksal. „Ingenieur – Mach etwas daraus, das nur du kannst.“ „Na super“, knurrte Esel, „ich darf was reparieren.“ Aber noch bevor sie lachen konnten, ruckte die Maschine ein letztes Mal. Eine dritte Karte erschien, leicht zerknittert, als wäre sie nicht ganz freiwillig gekommen. Darauf stand nur: „Zwecklos, aber glücklich.“ Teddy und Esel sahen sich an. Der Wind wehte durch die offene Tür. Der Krämerladen war still. Dann lachten sie – erst leise, dann laut, dann so, dass die Regale klirrten. Als sie wieder auf die Landstraße einbogen, war der Laden hinter ihnen verschwunden. Nur ein leerer Parkplatz blieb, und im Staub glitzerte ein Stück Papier, auf dem in blauer Tinte ein Schmetterling gezeichnet war.
-
Folge vom 05.10.2025Was kannst du eigentlich alles für Instrumente spielen?Es fing, wie so oft, ganz harmlos an: „Ich wollte nur mal kurz gucken, wie unser beliebtes KI-Intro klingen würde, wenn es echte Musiker spielen.“ Zwei Klicks später war Teddy in einem YouTube-Tutorial über orchestrale Sample-Libraries gefangen und wusste: Jetzt gibt’s kein Zurück mehr. Tage, Nächte, Tabs. Er las sich durch Foren, in denen Leute über Instrumente diskutierten, als wären es Weinnoten. Er lernte, dass ein echtes Orchester aus 60 Menschen besteht – oder aus 40 Gigabyte Strings. Er installierte Programme, deren Namen nach Raumschiffen klingen: Kontakt, Codify, Orchestral Tools. Und als er dann alles verstanden hatte, kam die Erkenntnis: Für eine echte Profi-Band müsste man rund 4.000 Euro investieren. Aber Teddy blieb dran. Er fand eine Möglichkeit, es outzusourcen in die weite Musikerinternetgemeinschaft. Am Ende saß er da, umgeben von blinkenden Spuren, und sagte nur: „Ich glaube, ich hab’s.“ Esel hörte zu, grinste – und sagte: „Klingt super, aber das alte Intro war auch gut.“ Zum Selberbasteln https://www.esel-und-teddy.de/wp-content/uploads/2025/10/garageband.band_.zip Akkorde und Text Ein Cast ein Pod Gesprochen wird hier flott Esel M. und Teddy K. Sind jetzt wieder da Ein Pod ein Cast Gesprochen wird hier fast (Nur über Sinnvolles) Esel und Teddy Es gibt auch schlechtere | A | A | F#m | F#m | D | D | E | | A | A | E | E | D | E | A | | D | D | D | A | D | E | A | → A