Unzählige Vereine in der ganzen Schweiz führen in diesen Wochen ein Lotto durch. Zu gewinnen gibt es Lebensmittelkörbe, Rollschinkli, ein Gutschein des Dorfladens. Die Events sind häufig ausverkauft und es spielen auch junge Menschen. Was zieht sie hier her?
«Input»-Redaktor Michael Bolliger reist nach Gettnau, LU, um dieser Frage nachzugehen. Ans Lotto der Läuferriege Ende November kamen rund 400 Spielende aus mehreren Kantonen und allen Generationen. «Ich spiele lieber mit anderen zusammen, als alleine zuhause am PC», freut sich eine der Teilnehmerinnen. Das gemeinschaftliche Erlebnis ist aber nur ein Grund, den jüngere Teilnehmende im Saal nennen, warum sie gerne ans Lotto kommen. Und: Das Verlustrisiko wird offenbar besser verkraftet, wenn ein guter Zweck dahintersteht, sagt die Verhaltensforscherin.
Habt ihr Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf eure Nachrichten an input@srf.ch – und wenn ihr euren Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählt.
____________________
- Autor: Michael Bolliger
- Publizistische Leitung: Anita Richner
____________________
Das ist «Input»:
Dem Leben in der Schweiz auf der Spur – mit all seinen Widersprüchen und Fragen. Der Podcast «Input» liefert jede Woche eine Reportage zu den Themen, die euch bewegen.
____________________
(00:00) Intro
(01:50) Ein Highlight des Lotto-Abends: Match zum Goldvreneli-Preis
(04:16) Was sind deine Glückszahlen?
(09:33) Jonas Hodel, OK-Präsident: Bedeutung des Lottoabends für den Verein
(11:34) Die Preise des Abends, und warum Fleisch alleine nicht mehr reicht
(17:52) Das sagt die Verhaltensforscherin, warum Vereinslottos auch für jüngere Menschen spannend sind?
(21:59) Das war ein cooler Abend!
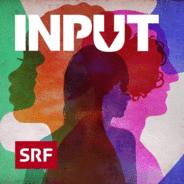
Kultur & Gesellschaft
Input Folgen
«Input» ist der Hintergrundpodcast, der sich Zeit fürs Leben nimmt. Wir vertiefen, was euch in eurem Alltag bewegt und berührt - sei es im Job, in der Partnerschaft oder im Freundeskreis. Diskutiert mit: input@srf.ch
Folgen von Input
100 Folgen
-
Folge vom 11.12.2024«Lotto im Saal» - Finden auch Jüngere cool
-
Folge vom 04.12.2024Jugendliche und psychische Probleme: «Ich weinte jeden Abend»Tosca (19) kämpft seit Jahren mit Depressionen. «Ich hatte Wutausbrüche und wusste nicht, wohin mit mir». 2020 erlebt sie einen psychischen Tiefpunkt, sie ist suizidal und muss gegen ihren Willen in eine Klinik eingewiesen werden. Bis heute hat sie depressive Phasen. Das belastet auch ihre Mutter: «Was habe ich falsch gemacht?».Tosca ist kein Einzelfall: Laut UNICEF leidet ein Drittel der jungen Menschen in der Schweiz an psychischen Problemen. Und auch Peter Sonderegger, Schulpsychologe und Vorstand Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie sagt, dass die Depressionen und Angststörungen bei den Schüler:innen zugenommen habe. «Die Angst, den Leistungsanforderungen nicht zu genügen, ist ein wichtiger Teil». Wieso geht es so vielen Jugendlichen in der Schweiz psychisch schlecht? Und wer fängt sie auf? Diesen Fragen geht Input-Host Anna Kreidler nach. ____________________ Habt ihr Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf eure Nachrichten an input@srf.ch – und wenn ihr euren Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählt. ____________________ 00:00 Intro 01:19 Wie sich die Depression in Toscas Leben schlich 06:55 Homeschooling und der Effekt der Pandemie auf die Schüler:innen 12:00 Mutter Marions Erfahrung mit Toscas Erkrankung 17:50 Die Rolle der Eltern 19:19 Werden die Jugendlichen nicht ernstgenommen? 23:22 Was und wer kann helfen? 26:52 Teaser rec.-Reportage 27:40 Fazit ____________________ In dieser Episode zu hören - Tosca und ihre Mutter Marion - Peter Sonderegger, Schulpsychologe ____________________ - Autorin: Anna Kreidler - Publizistische Leitung: Anita Richner ____________________ Das ist «Input»: Dem Leben in der Schweiz auf der Spur – mit all seinen Widersprüchen und Fragen. Der Podcast «Input» liefert jede Woche eine Reportage zu den Themen, die euch bewegen.
-
Folge vom 27.11.2024Plötzlich arm: Von der Führungsposition in die SozialhilfeFrüher hatte Eva* eine leitende Position, seit kurzem lebt sie von Sozialhilfe. Stück für Stück verabschiedet sie sich von ihrem alten Leben: Auto verkaufen, abgelaufene Lebensmittel abholen. «Input» zeigt, wie Eva zwischen Dankbarkeit, Wut und Erschöpfung schwankt und dennoch optimistisch bleibt. Pro Monat bleiben Eva und ihrem achtjährigen Sohn nach Abzug aller Fixkosten Fr. 320.- zur Verfügung für Lebensmittel, Hygieneprodukte oder Geschenke für Kindergeburtstage. Damit lebt sie unter der Armutsgrenze – genau wie etwa 700'000 andere Schweizerinnen und Schweizer. «Manchmal ist alles wirklich ein riesengrosser Scheiss». Meistens aber ist sie mit ihrem Leben in Armut sehr versöhnt. Was ihr unter anderem dabei hilft: Radikale Akzeptanz. *Name der Redaktion bekannt ____________________ In dieser Episode zu hören: Eva Jera*, 50, armutsbetroffen und Mutter eines achtjährigen Sohns *Name der Redaktion bekannt ____________________ Habt ihr Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf eure Nachrichten an input@srf.ch – und wenn ihr euren Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählt. ____________________ - Autorin: Mariel Kreis - Publizistische Leitung: Anita Richner ____________________ Das ist «Input»: Dem Leben in der Schweiz auf der Spur – mit all seinen Widersprüchen und Fragen. Der Podcast «Input» liefert jede Woche eine Reportage zu den Themen, die euch bewegen. ____________________ (00:00) Intro (02:30) In der Warteschlange für das Messpäckli (10:36) Zahlen und Fakten zu Armut (11:53) Eva erzählt von ihrem Leben in Armut (25:37) Was Eva hilft, optimistisch zu bleiben
-
Folge vom 20.11.2024Der Wald im Herbst: Ein Spaziergang mit Geräuschen und GefühlenDer Wald, ein grosser und vielfältiger Lebensraum. Fast die Hälfte aller Pflanzen und Tiere in der Schweiz leben da, die Hälfte der Bevölkerung geht regelmässig in den Wald. Er dient als Erholungsraum, Schutz vor Naturgefahren und Holzlieferant. Aber was macht der Wald eigentlich im Herbst? Jetzt, wo der Nebel zwischen den Bäumen schwebt und die Blätter fallen, wird es im Wald stiller. Eine gute Gelegenheit, findet «Input»-Host Michael Bolliger, einmal zu schauen, was in dieser Jahreszeit im Wald läuft. Er trifft auf seinem Spaziergang Menschen, die die Ruhe suchen, solche, die Bäume fällen, damit andere mehr Platz haben und einen, der tief in den Boden schaut, wo im Herbst das grosse Kompostieren beginnt, für gute Erde im Frühling. Ein Spaziergang mit Geräuschen und Gefühlen. ____________________ In dieser Episode zu hören - Passant:innen im Bremgartenwald, Bern - Urs Emch, Forstbetriebe Burgergemeinde Bern - Markus Rufener, Forstbetriebe Burgergemeinde Bern - Frank Hagedorn, Gruppenleiter Waldböden, WSL, Birmensdorf, ZH ____________________ Habt ihr Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf eure Nachrichten an input@srf.ch – und wenn ihr euren Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählt. ____________________ - Autor:in: Michael Bolliger - Publizistische Leitung: Anita Richner ____________________ Das ist «Input»: Dem Leben in der Schweiz auf der Spur – mit all seinen Widersprüchen und Fragen. Der Podcast «Input» liefert jede Woche eine Reportage zu den Themen, die euch bewegen. ____________________ (00:00 - 01:45) Intro (01:30 - 07:40) Gedanken und Fakten zum Wald (07:40 - 16:25) "Durchforsten" im Bremgartenwald und Fakten zur Holzwirtschaft (16:25 - 19:40) Gedanken zum Wald (19:40 - 28:55) Wie die Blätter fallen, zu Humus werden und was die Wurzeln tun (29:55 - 30:00) Fazit (30:00 - 30:52) Aufruf Vaterschaftsurlaub
